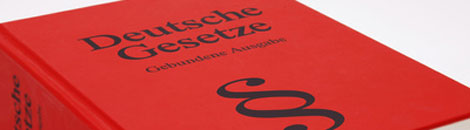Sicherheit in Freibädern
Immer wieder kommt es in Freibädern zu Übergriffen bzw. Gewalt gegen Besucherinnen und Besucher. Zumeist betrifft dies jugendliche Mädchen und Jungen. Insofern muss der Betreiber des Bades prüfen, ob bzw. welche betrieblichen Maßnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit des Badebetriebes zu gewährleisten. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen gibt in der als Anlage beigefügten Veröffentlichung zur „Sicherheit in Freibädern“ wichtige Hinweise, auf die wir verweisen (Anlage).
Aus rechtlicher Sicht ist zu den verschiedenen Maßnahmen folgendes auszuführen:
Verfügung eines Hausverbotes
Ausgangspunkt und Rechtsgrundlage für die Beschränkung des Zutritts zu öffentlichen Einrichtungen ist das nach öffentlich-rechtlichen Maßstäben zu beurteilende Hausrecht der Stadt als Verantwortliche für die öffentlichen Einrichtungen (§ 20 HGO). Das Hausrecht beruht als notwendiger Annex auf der Zuweisung der eigentlichen Verwaltungsaufgabe und obliegt der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister (vgl. etwa BSG, Beschl. v. 01.04.2009 – B 14 SF 1/08 R – Rdnr. 11, 16; OVG Hamburg, Beschl. v. 17.10.2013 – 3 SO 119/13 – Rdnr. 10; OVG NRW, Urt. v. 05.05.2017 – 15 A 3048/15 – Rdnr. 52; VG Kassel, Beschl. v. 23.03.2022 – 3 L 347/22.KS –; VG Neustadt, Beschl. v. 10.02.2010 – 4 L 81/10.NW –; VG Hannover, Urt. v. 18.05.2018 – 1 A 7030/17 –; juris). Es beinhaltet die Befugnis zur Wahrung der Zweckbestimmung eines im Verwaltungsgebrauch stehenden Gebäudes sowie zur Abwehr von Störungen des Betriebes über den Zutritt und das Verweilen von Personen darin zu bestimmen und Nichtberechtigte auszuweisen bzw. ihnen das Betreten zu verbieten. Diese Befugnis ist durch die allgemeinen Regeln über den pflichtgemäßen Ermessensgebrauch (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit) durch Verwaltungsbehörden beschränkt (VG Anspach, Beschl. v. 30.04.2021 – AN 18 E 21.00748 –, Rdnr. 29 –; juris). Die Erteilung eines behördlichen Hausverbotes ist danach gerechtfertigt, wenn der Ablauf nachhaltig gestört wird und mit einer Wiederholung derartiger Vorfälle zu rechnen ist (VG Neustadt, a.a.O., Rdnr. 13). Bei der Begründung eines Hausverbotes müssen die Tatsachen, die zur Störung des Betriebes geführt haben, detailliert mitgeteilt werden. Darüber hinaus muss dargelegt werden, aus welchen Gründen in Zukunft wieder mit einer Störung zu rechnen ist. Schließlich müssen Ausführungen darüber erfolgen, welche Erwägungen für die Ausgestaltung des Hausverbotes in der konkreten Form (unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit) maßgebend waren (VG Hannover, a.a.O., Rdnr. 26). Hier ist zu berücksichtigen, dass das Hausverbot präventiven Charakter hat, indem es darauf abzielt, zukünftige Störungen des Betriebsablaufs in der Einrichtung zu vermeiden und keinen repressiven Charakter hat, also nicht dazu dient, den Störer der Einrichtung für seine Handlung zu bestrafen (VG Hannover, a.a.O., Rdnr. 32; VG Neustadt a.a.O., Rdnr. 12, 13).
Unter Berücksichtigung dieser von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze ist im Einzelfall zu prüfen, ob bzw. inwieweit ein Hausverbot ausgesprochen werden kann. Hier sind die einzelnen Vorfälle sowie die Schwere der Vorfälle zu berücksichtigen. Aufgrund des lediglich präventiven und nicht repressiven Charakters der Hausverbotes kann dieses grundsätzlich nur befristet ausgesprochen werden. Dabei ist unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des VG Hannover sowie des VG Neustadt davon auszugehen, dass ein Ausspruch des Hausverbotes grundsätzlich lediglich für eine Badesaison möglich ist.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein Widerspruch gegen das Hausverbot aufschiebende Wirkung entfalten würde. Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4. VwGO entfällt die aufschiebende Wirkung in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder über den Widerspruch zu entscheiden hat, besonders angeordnet wird. Insofern empfiehlt es sich, bei entsprechenden Hausverboten, ergänzend die sofortige Vollziehung anzuordnen, damit die aufschiebende Wirkung bei Einlegen eines Widerspruchs nicht greift. Dabei ist darauf zu achten, dass die sofortige Vollziehung im Einzelnen begründet wird (§ 80 Abs. 3 VwGO). Zwar bedarf es einer besonderen Begründung nicht, wenn die Behörde bei Gefahr in Verzug, insbesondere bei drohenden Nachteilen für Leben, Gesundheit oder Eigentum vorsorglich eine als solche bezeichnete Notstandsmaßnahme im öffentlichen Interesse trifft. Die Voraussetzungen hierfür sind allerdings sehr restriktiv, sodass wir auf jeden Fall empfehlen, die Anordnung einer sofortigen Vollziehung ausführlich zu begründen.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass vor Erlass des Hausverbotes eine Anhörung gem. § 28 HVwVfG zu erfolgen hat. Dem Adressaten muss das Recht gewährt werden, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Nach Abs. 2 kann zwar von der Anhörung abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr in Verzug oder im öffentlichen Interesse notwendig erscheint. Wir empfehlen grundsätzlich in entsprechenden Fällen eine Anhörung vorzunehmen. In der Anhörung müssen die einzelnen Vorfälle dargelegt werden. Dem Adressaten ist eine Frist zur Stellungnahme einzuräumen. Die Anhörung kann grundsätzlich aber auch im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nachgeholt werden.
Namenskontrollen
Gemäß § 20 Abs. 1 HGO sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen „im Rahmen der bestehenden Vorschriften“ der Gemeinde zu nutzen. Insofern obliegt es dem Träger der öffentlichen Einrichtung hier Vorgaben in Form einer Badeordnung vorzugeben. In diesem Zusammenhang halten wir es für zulässig, in einer Badeordnung zu regeln, dass bei Eintritt in die öffentliche Einrichtung – hier in das Freibad – die Vorlage von ausweisenden Dokumenten verlangt werden kann. Die Regelung einer Einsichtnahme in ausweisende Dokumente wird auch deshalb für zulässig erachtet, da ansonsten die Vollziehung des Hausverbotes „ins Leere gehen“ würde. Nur wenn das Kassenpersonal in Kenntnis des Namens ist und eine Abgleichung vornehmen kann, kann es prüfen, ob hier ein Hausverbot erteilt wurde.
Herstellung von Lichtbildern
Gemäß § 22 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotografie (Kunsturheberrechtsgesetz, KUG) dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Dabei führt grundsätzlich bereits die Verbreitung an Einzelpersonen zu einem der Kontrolle und dem Selbstbestimmungsrecht des Abgebildeten vorbehaltenen Übergang des Bildnisses in die Verfügungsgewalt eines anderen (Dreier/Schulze, UrhG, Kommentar zum KUG, § 22 KUG, Rdnr. 9; LG Aachen, Urt. v. 29.10.2015 – 447 Cs 249/15 – juris). Es spricht deshalb einiges dafür, dass bereits die Weitergabe des Bildes an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Verwaltung bzw. des Kassenpersonals ein Verbreiten im Sinne des § 22 KUG darstellen würde. Zwar hat der BGH bei der Weitergabe von Bildnissen durch eine Bildarchivagentur an ein Presseunternehmen (BGH, Urt. v. 07.12.2010, GRUR 2011, 266 – juris) für den Einzelfall entschieden, dass der presseintern bleibende Abruf von Bildnissen durch Presseunternehmen keine Verbreitungshandlung des Betreibers eines Bildarchivs darstelle, da das Bildarchiv in diesem Fall eine typischerweise pressebezogene Hilfstätigkeit erbringe, die vergleichbar mit dem Fall sei, dass ein Medienunternehmen auf ein eigenes Bildarchiv zurückgreife. Dieser Fall ist nach diesseitiger Sicht allerdings nicht vergleichbar, da entsprechende Bilder nicht typischerweise von der Verwaltung erstellt werden. Insofern bestehen nicht unerhebliche rechtliche Bedenken, wenn hier Lichtbilder angefertigt würden.
Taschenkontrollen durch das Kassenpersonal
Wie bereits unter Nr. 3. dargelegt, sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden lediglich „im Rahmen der bestehenden Vorschriften“ berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu nutzen (§ 20 HGO). Insofern wäre es nach diesseitiger Sicht möglich, in einer Badeordnung entsprechende Taschenkontrollen vorzusehen. Hier müsste allerdings im Einzelnen geregelt sein, wer die Befugnis hat, die Taschenkontrollen durchzuführen.
Überwachungskameras
Gemäß § 14 Abs. 3 S. 1 HSOG können die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden zur Abwehr einer Gefahr oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten drohen, öffentlich zugängliche Orte mittels Bildübertragung offen beobachten und aufzeichnen. Ob die Voraussetzungen vorliegen, ist auf der Grundlage einer ortsbezogenen Lagebeurteilung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit zu ermitteln und zu dokumentieren. Laut dem Willen des Gesetzgebers soll hier nur eine Beschränkung auf Kriminalitätsschwerpunkte erfolgen (vgl. LT-Drucks. 15/848 S. 4). So wurde beispielsweise durch die Rechtsprechung bestätigt, dass an der Hauptwache und der Konstablerwache in Frankfurt am Main die Voraussetzungen für eine Videoüberwachung aufgrund einer hohen zu verzeichnenden Kriminalitätsbelastung vorliegen. Im Gegensatz dazu wird nach hiesiger Auffassung das kürzliche Ereignis alleinig nicht ausreichen um eine Videoüberwachung zu rechtfertigen, zumal es sich bei dem Schwimmbad aufgrund der leicht bekleideten Badegäste um einen sensiblen Bereich handelt, der einen höheren Schutz genießen muss. Etwas anderes kann sich nur daraus ergeben, wenn es im Schwimmbad in der Vergangenheit vermehrt zu begangenen Straftaten kam und damit zu rechnen ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit Straftaten begangen werden.